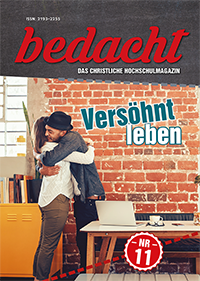„Freude schöner Götterfunken“
Jeder kennt sie: die Freude. Sie ist universal und allen Menschen gemein, sofern sie in der Lage sind, sich überhaupt zu freuen. Schiller schreibt eine ganze Ode an die Freude und sehr schlaue Psychologen und Neurowissenschaftler zerbrechen sich den Kopf über ihre Chemie. Aber woher kommt sie? Zumindest etymologisch sind wir uns recht einig: “Freude” kommt von “froh”, und das althochdeutsche “fro” teilt sich den Ursprung mit dem deutschen Wort für “Frosch”, beide sind nämlich aus dem Wort für “hüpfen” entstanden. Wir hüpfen vor Freude. Christen haben sich an zahlreiche Gebote zu halten und sind trotzdem recht fröhlich. Aber warum eigentlich?

Freude über die Schöpfung
Es sind universale Dinge, manchmal alltägliche Situationen, in denen Menschen ein Stück der atemberaubenden Schönheit dieser Welt in unmittelbarer Intensität erleben: Es sind Momente überschwänglicher Freude und phantastischen Staunens: die unbeschreibliche Ästhetik der Sonnenaufgänge über dem Meer. Die gewaltigen schneebedeckten Bergketten. Das gewaltige Tosen der Wasserfälle. Die Vollkommenheit besonderer Musikstücke, wie Bachs “Air”, oder die Geburt und der erste Schrei eines Kindes. Die faszinierende Anatomie der Augen. Und allem voran der Moment, in dem Liebe auf Gegenliebe trifft. Diese Welt erzählt uns eine Geschichte von Ewigkeit und Schönheit und versetzt uns in Staunen und Freude. <h1">Freude über eine wiederhergestellte Beziehung Es gibt indes eine weitere Freude, spezifischer und unbändiger. Wir lesen davon in einer der besten Kurzgeschichten, die jemals geschrieben wurden: Es geht um eine Familientragödie, um einen verzweifelten Vater, der Tag und Nacht darauf wartet, dass sein Sohn nach Hause zurückkehrt. Was war passiert? Der Vater, ein Mann ohne finanzielle Sorgen, mit großer Dienerschaft und Haus, hat zwei Söhne. Der jüngere der beiden tritt eines Tages zu ihm und verlangt, sein Erbe ausgezahlt zu bekommen. Schweren Herzens erfüllt der Vater ihm diese Bitte, woraufhin dieser sich in ein fernes Land absetzt und eine Party nach der nächsten feiert, bis das ganze Geld aufgebraucht ist. Dummerweise bricht gleich-zeitig eine schwere Hungersnot aus, woraufhin dem Sohn nichts anderes übrig bleibt, als dem erniedrigendsten Job überhaupt nachzugehen: Um zu überleben, verdient er sich einen Hungerslohn, indem er Dixi-Klos auf Baustellen putzt. Schließlich besinnt er sich und überlegt, zurück zu seinem Vater zu gehen, ihn um Verzeihung zu bitten und darum, bei ihm als Lohnarbeiter anheuern zu dürfen. Also schleppt er sich, ausgezehrt und gezeichnet von Hunger und Leid, in Richtung des Hauses seines Vaters. Dieser, verzweifelt und voller Leid über den Verlust des Sohnes, sieht in der Ferne plötzlich jemanden, der seinem Sohn recht ähnlich sieht. Als er näherkommt, bleibt kein Zweifel mehr: Es ist der Sohn! Der Sohn! Er schreit seinem Diener zu, den Armani-Anzug, die Rentierlederschuhe von Russian Calf und die unlimitierte American Express Black Card zu holen – und alles dem Sohn zu geben! Und noch mehr: Den fettgemästeten Bio-Hirsch aus dem hauseigenen Garten soll er schlachten und ein großes Fest vorbereiten! Der Vater schmeißt den Gehstock zur Seite und rennt dem Sohn entgegen, so schnell es seine alten Knochen zulassen. Ihm wirft sich der ausgezehrte Sohn vor die Füße und schluchzt: „Vater, ich bin es nicht wert, dass ich dein Sohn heiße!” Der Vater hebt ihn auf, schaut ihn voller Liebe und Glück an und antwortet: „Du mein Sohn warst fort und wie tot für mich, und jetzt bist du wieder lebendig geworden!” Dieser Teil der Geschichte soll bis hierhin reichen (nachzulesen in Lukas 15, 11 ff.). Diese wunderbare Geschichte der Freude über eine wiederhergestellte Beziehung finden wir in der Bibel. Sie selbst handelt davon: Sie beginnt mit der Erschaffung des Menschen durch Gott, erzählt vom Zerbrechen der Beziehung zwischen Gott und ihm und gibt uns am Ende eine Idee von der Wiederherstellung dieser Beziehung.
Diese wunderbare Geschichte der Freude über eine wiederhergestellte Beziehung finden wir in der Bibel. Sie selbst handelt davon: Sie beginnt mit der Erschaffung des Menschen durch Gott, erzählt vom Zerbrechen der Beziehung zwischen Gott und ihm und gibt uns am Ende eine Idee von der Wiederherstellung dieser Beziehung. Die Freude über diese wiederhergestellte Beziehung ist eine Freude, die man wissen muss. Das bedeutet, dass sie erst durch das Wissen um sie erfahrbar wird. Während die Freude an der Schöpfung eine universale, für jeden frei zugäng-liche Quelle der Freude ist, setzt die Freude über die Wiederherstellung einer Beziehung voraus, dass man um diese Beziehung weiß, um deren Zerbrechen und ebenso um deren Wiederherstellung. Ist eine geschätzte Beziehung verloren und wird sie wiederhergestellt, birgt das Grund zur Freude, egal ob religiös oder kirchenfern.
Eine der atheistischsten Gegenden der Welt liegt direkt um die Ecke: Berlin, Hellersdorf. Einer Studie der University of Chicago zufolge ist es mit einem Anteil von rund 46% „überzeugter Atheisten” sogar die atheistischste Region überhaupt. Im sozialismusgeprägten Osten Deutschlands ist Religion während meiner Kindheit dort kein Thema gewesen. Rückblickend hätte ich mich damals nicht als Atheist bezeichnet, denn Atheisten negieren per definitionem die Frage nach einer metaphysischen Instanz bzw. nach Gott. Ich aber habe mir die Frage nie gestellt. Ich war nach Erich Loest ein “Untheist”, es ging „nicht mehr um eine Verneinung des Gottesglaubens, sondern um die völlige Abwesenheit jedes Glaubens” (Alexander Garth: Die Welt ist nicht genug, München: 2010, S. 16 f.). Erst die Erfahrung, Menschen kennenzulernen, die eine mir unbekannte Freude im Herzen zu tragen schienen, eine Freude über das Heilwerden einer zerbrochenen Beziehung, führte dazu, dass ich heute voller Fröhlichkeit sagen kann: Ich war der verlorene Sohn! Dies ist auch der Grund, warum Christen, also Menschen, die Gott lieben und von ganzem Herzen suchen, am liebsten von Vergebung sprechen: Es geht darum, die Freude Gottes über verloren Geglaubte zu teilen. Die Freude Gottes zu teilen über Menschen, die Dinge tun, die wenig Anlass zur Freude bieten, aber als Menschen doch und unbedingt geliebt und angenommen sind. Natürlich ist auch diese Art der Freude nicht exklusiv für Christen reserviert.
Freude der Hoffnung
Es gibt nun drittens eine weitere Freude, die nun tatsächlich den Christen vorbehalten ist, aber nicht aus elitären Gründen, sondern aus der Notwendigkeit heraus, Christ zu sein, um sie zu empfinden. Diese Freude ist die Freude des Heiligen Geistes (siehe: Römer 14, 17). Die Erläuterung dieser Freude soll mit dem Zitat eines großartigen Mannes beginnen. Als Rumänien, nachdem es gegen Ende des Zweiten Weltkrieges unter sowjetischen Einfluss geriet, in den 1950er-Jahren nach kommunistischem Vorbild umgestaltet wurde, spitzte sich die Lage für Christen immer weiter zu. Es wurde lebensgefährlich, Christ zu sein. Zwar existierte so etwas wie eine Untergrundkirche, aber sie war schwach und gebeutelt durch die Geheimpolizei und den staatlich diktierten Atheismus. In dieser Zeit predigte der evangelische Pfarrer Richard Wurmbrand das Evangelium, wofür er 14 Jahre lang in verschiedenen staatlichen Gefängnissen inhaftiert und brutal gefoltert wurde. In seinem Buch „Gefoltert für Christus” lesen wir diese unglaublichen Zeilen: „Wenn ich auf meine 14 Jahre Gefängnis zurückblicke, so will mir scheinen, daß es trotz allem auch eine Zeit voller Freude war. Andere Häftlinge und auch unsere Wächter gerieten immer wieder in Verwunderung darüber, wie Christen sogar unter den furchtbarsten Umständen noch fröhlich sein konnten. Wir ließen uns nicht hindern zu singen, obwohl wir dafür geschlagen wurden. (...) Es gab im Gefängnis Christen, die von ihrer Freude so erfüllt waren, dass sie tatsächlich getanzt haben” (Wurmbrand: Gefoltert für Christus, London: 1967). Woher kommt diese Freude? Es ist die Freude über eine Hoffnung, die aus dem Wissen herrührt, geliebt und angenommen zu sein. Es ist das Wissen um den eigenen Wert und die eigene Identität, die nur im Lichte Gottes vollends gestiftet wird. Dieses Wissen beantwortet die grundlegenden Fragen des Lebens: Woher komme ich? Wozu lebe ich? Wohin gehe ich? Innerhalb der christlichen Ethik lassen sich diese Fragen erschöpfend beantworten: Der Mensch ist geschaffen als Ebenbild Gottes, woraus er seine Identität und Dignität schöpft, die aber nicht elitär oder arrogant, sondern durch und durch barmherzig ist im Wissen, dass niemand durch Taten vor Gott bestehen kann, sondern nur durch seine unverdiente und umfassende Annahme des reuigen Menschen. Im christlichen Jargon wird diese Annahme Gnade genannt. Daraus ergibt sich der christliche Handlungskatalog, den Jesus selbst auf die Formel bringt: “Darum liebt ihn [den Herrn] von ganzem Herzen und mit ganzem Willen, mit ganzem Verstand und mit aller Kraft [und] liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst!” (Markus 12, 30 – 31). Diese Freude der Hoffnung, so zeigen uns zahllose Geschichten von Christen, die wegen ihres Glaubens zu Tode gefoltert wurden, ist bis in den Tod hinein und darüber hinaus tragfähig, denn die Frage nach dem “Wohin” ist ebenfalls beantwortet: in die Ewigkeit der Gegenwart Gottes. Um mit den Worten eines Songautors in der Bibel zu sprechen: „Ich aber setze mein Vertrauen auf dich, meinen Herrn; dir nahe zu sein ist mein ganzes Glück” (Psalm 73, 28).
Woher kommt diese Freude? Es ist die Freude über eine Hoffnung, die aus dem Wissen herrührt, geliebt und angenommen zu sein. Es ist das Wissen um den eigenen Wert und die eigene Identität, die nur im Lichte Gottes vollends gestiftet wird. Dieses Wissen beantwortet die grundlegenden Fragen des Lebens: Woher komme ich? Wozu lebe ich? Wohin gehe ich? Innerhalb der christlichen Ethik lassen sich diese Fragen erschöpfend beantworten: Der Mensch ist geschaffen als Ebenbild Gottes, woraus er seine Identität und Dignität schöpft, die aber nicht elitär oder arrogant, sondern durch und durch barmherzig ist im Wissen, dass niemand durch Taten vor Gott bestehen kann, sondern nur durch seine unverdiente und umfassende Annahme des reuigen Menschen. Im christlichen Jargon wird diese Annahme Gnade genannt. Daraus ergibt sich der christliche Handlungskatalog, den Jesus selbst auf die Formel bringt: “Darum liebt ihn [den Herrn] von ganzem Herzen und mit ganzem Willen, mit ganzem Verstand und mit aller Kraft [und] liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst!” (Markus 12, 30 – 31). Diese Freude der Hoffnung, so zeigen uns zahllose Geschichten von Christen, die wegen ihres Glaubens zu Tode gefoltert wurden, ist bis in den Tod hinein und darüber hinaus tragfähig, denn die Frage nach dem “Wohin” ist ebenfalls beantwortet: in die Ewigkeit der Gegenwart Gottes. Um mit den Worten eines Songautors in der Bibel zu sprechen: „Ich aber setze mein Vertrauen auf dich, meinen Herrn; dir nahe zu sein ist mein ganzes Glück” (Psalm 73, 28).Bei dieser Freude geht es um eine sehr gute Nachricht. Das altgriechische Wort hierfür ist “Evangelium”. Dieses Evangelium ist kostbar. Es geht hierbei nicht um eine billige Wegwerfware, die wir unüberlegt allen Menschen vorsetzen, ob sie sie hören wollen oder nicht (wir Christen machen oft einen großen Fehler: Wir beantworten Fragen, die niemand gestellt hat). Christ zu sein bedeutet, das Leben auf ein neues Fundament zu stellen. Es bedeutet einen radikalen Paradigmenwechsel. Das Christentum ist kein Sahnehäubchen auf dem eigenen religiösen Potpourri. Jesus lässt sich nicht einreihen in die Reihe von Männern und Frauen, die es gut gemeint haben mit sinnsuchenden Menschen. Es geht ums Ganze. Stimmt die Sache um Jesus, ist es das Beste, was der Menschheit passieren konnte, und eine nie versiegende Quelle unbändiger Freude. Das Leben Jesu bürgt für eine Qualität des Menschseins, die völlig außerhalb dessen liegt, was bisher war: Gott selbst kommt auf die Erde und stirbt, um eine zerstörte Beziehung wiederherzustellen und um den Menschen wieder zu seiner eigentlichen Identität zu führen: geliebte Freunde und Kinder des lebendigen Gottes, mit der Lizenz zur Freude.